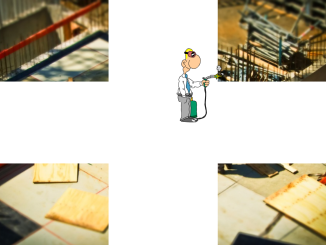Ich schreibe diesen Text, weil ich nicht geschafft habe, worauf die überwiegende Mehrheit der Teilnehmenden dieses Forums hinarbeitet: Ich bin keine Patentanwältin geworden. Ich werde mich auch nicht an der EQE versuchen, um zugelassene Vertreterin vor dem Europäischen Patentamt zu werden.
Nach einem Jahr Ausbildung erhielt ich eine äußerst durchwachsene Bewertung meines Betreuers. Er sei sich nicht sicher, ob ich wirklich wisse, was es bedeutet, Anwältin zu sein – der Satz hallt noch heute in mir nach.
Alle Erfahrungsberichte von Kandidaten:
– Eine Chronik des Scheiterns?
– Mein Corona-Amtsjahr
– Traumberuf Patentanwalt? Ansichten eines Kandidaten.
– Praktikum bei einem Gericht für Patentstreitsachen
Die erste Klausur des Fernstudiums habe ich damals nicht bestanden. 77 Punkte – mangelhaft – standen in dem Brief, den ich an dem nasskalten Februartag aus dem Briefkasten gezogen habe. Da war ich bereits auf dem Weg zur Fotografin, um Bewerbungsbilder machen zu lassen, denn zum Abbruch der Ausbildung hatte ich mich da längst entschieden.
Definitionsgemäß ist das Scheitern das Nicht-Erreichen eines Ziels, das Nicht-Erfolg-Haben und somit hier natürlich anwendbar. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob ich dieses Scheitern wirklich alleine vertreten muss.
Auf dem Papier bringe ich alle Voraussetzungen mit. Ich habe nach meinem Physikstudium in der angewandten Oberflächenphysik promoviert, die Voraussetzungen des naturwissenschaftlichen oder technischen Hintergrunds und das Jahr praktisch-technischer Tätigkeit also mühelos erfüllt. Die besten Momente meiner Promotion waren die, in denen ich schreiben konnte, oder, noch besser, meine Ergebnisse in Vorträgen präsentieren konnte. Ich bin eines jener raren Wesen, die sowohl schreiben als auch sich in schwierige naturwissenschaftliche Konzepte hineindenken können. Analytisches und lösungsorientiertes Denken – jene Qualitäten, die man als Floskeln so gerne ins Anschreiben der Bewerbung schreibt, bringe ich mit.
Ein knappes Jahr vor Ende meiner Promotion stieß ich auf das Berufsbild des Patentanwalts. Ich glaubte, die perfekte Übereinstimmung zu meinen Neigungen und Qualifikationen gefunden zu haben. An der Schnittstelle von Technik und Recht – das Verheiraten von Sprache mit naturwissenschaftlich-technischem Verständnis, das musste es doch sein, oder etwa nicht?
Ein halbes Jahr später hatte ich nach Vorstellungsgespräch und Probearbeiten den Vertrag in der Tasche, in einer mittelgroßen Kanzlei Patentanwaltskandidatin zu werden.
Aber was war denn dann schiefgelaufen?
Ich lebe in einer kleinen Stadt, die nur aus historisch gewachsenen Gründen über eine technische Universität verfügt. Die Stadt ist so klein, dass ich, als ich zum ersten Mal von ihr hörte, nur sagte: „Wie bitte, wo?“. In dieser Stadt ist kein Patentanwalt ansässig. Im näheren Umkreis gibt es zwar einige, diese sind jedoch nicht bereit oder fähig das finanzielle Risiko einzugehen, das die Ausbildung einer Kandidatin mit sich bringt.
Aus diesem Grund musste ich in der nächstgelegenen größeren Stadt auf die Suche nach einer Stelle gehen. Die Kanzlei, die mich schließlich als Kandidatin aufnahm, ist eine Stunde mit dem Auto von meinem Wohnort entfernt, mit Auto und Zug anderthalb Stunden. Von der monatlich stattfindenden Arbeitsgemeinschaft fuhr ich fast zwei Stunden nach Hause. Um gegen acht Uhr an meinem Schreibtisch in der Kanzlei zu sitzen, musste ich um viertel nach sechs das Haus verlassen. Der Rückweg dauerte genauso lange. Nach zwölfeinhalb Stunden Abwesenheit war ich endlich wieder zu Hause. Schon beim Schreiben dieser Zeilen fühle ich die Erschöpfung.
Nach fünf Monaten Ausbildung, die ich auf diese Weise verbrachte, kam die Covid-19-Pandemie in Deutschland an. Plötzlich erlebte unser Land den kompletten Stillstand, alle waren zu Hause und versuchten sich im Homeoffice. Erziehende sollten parallel zu ihrer Erwerbsarbeit auch die Kinderbetreuung stemmen, denn Schulen, Kindergärten und Kitas waren geschlossen.
Ich habe einen kleinen Sohn. Als ich mich dazu entschieden habe, die Ausbildung zu wagen, habe ich eigentlich nur gefragt, ob es mit meinem Dasein als Mutter vereinbar ist. Ob ich das schaffe, ob es inhaltlich passt, das hatte ich schon nach dem Probearbeiten in der Kanzlei kategorisch mit Ja beantwortet.
Die Eingewöhnung in den Kindergarten, dieses einschneidende Erlebnis im Leben meines Sohnes, bekam ich nicht mit, denn ich war für die Auftaktveranstaltung des berufsbegleitenden Studiums im Hotel Arcadeon in Hagen und erfuhr eine Druckbetankung mit juristischem Wissen. Den Kindergarten bekam ich auch Wochen später noch nicht zu Gesicht. Ich ging aus dem Haus, wenn mein Sohn gerade wach wurde und kam gerade rechtzeitig zu einem späten Abendessen wieder. Bringen und Holen, die Kommunikation mit dem Kindergarten, alles machte mein Mann, der fünf Minuten zu Fuß entfernt vom Kindergarten arbeitet.
Der Aufenthalt in Hagen erfolgte kurz vor dem ersten Lockdown. Meine Kanzlei, von der Situation wie viele andere überfordert, ordnete ihre Kandidatin ziemlich weit unten auf der Prioritätsliste ein. Mir war das recht, denn auch ich war komplett überfordert damit, plötzlich in Vollzeit eine Ausbildung zu durchlaufen, ein berufsbegleitendes Studium zu absolvieren und die Arbeitsgemeinschaften vorzubereiten – und das alles nun von zu Hause aus, abgeschnitten von meiner Kanzlei und meinen Ausbildern und vor allem parallel zur Betreuung unseres Sohnes.
Mein Mann und ich versuchten, uns alles halbwegs gerecht aufzuteilen, sodass jeder von uns am Tag wenigstens einige Stunden am Stück ungestört arbeiten konnte. Meiner Kanzlei hatte ich in Panik kommuniziert, dass ich keinesfalls die vereinbarten acht Stunden am Tag leisten könnte. Ich geriet an die Grenzen meiner geistigen Gesundheit. Noch heute bin ich dankbar für das Verständnis, das mir mein Vorgesetzter entgegenbrachte.
Nachdem die erste Pandemiewelle überwunden war, durchlebte ich gute Monate meiner Ausbildung. Mein Studium machte mir Spaß und brachte mich mit den Menschen zusammen, mit denen ich auch heute noch befreundet bin. In der Kanzlei hatte ich die Möglichkeit, mit einem anderen Anwalt zusammenzuarbeiten und auch dieser Perspektivwechsel brachte mich zusehends weiter.
Bei allem Weiterkommen wurde mir jedoch zunehmend klar, dass ich anfing, mit dem Berufsbild des Patentanwalts zu hadern. Ich liebe kreatives Gestalten und Präsentieren, bei Vorträgen blühe ich auf. Am Schreiben liebe ich die Mühelosigkeit, den Moment des Flusses. Doch plötzlich merkte ich, wie ich sogar beim Verfassen privater Mails in den Schreibmodus verfiel, den ich mir während der Arbeit antrainiert hatte – kein Fluss, sondern mühseliges, kleinteiliges Schreiben, bei dem die Wörter einzeln und nacheinander auf die Goldwaage gelegt werden.
Zunehmend entmutigt war ich auch von der schieren Menge an Dingen, die ich noch nicht beherrschte. Mein hoher Anspruch an mich selber übersetzte sich in einen starken Druck, der mich regelrecht verkrampfen ließ und von dem ich nicht loskam. Ich konnte die Monate des Lockdowns, in denen ich kaum etwas leisten konnte, nie wirklich überwinden – damit einhergehend auch nie das Gefühl der Unzulänglichkeit. Die Gefahr hinter diesen Empfindungen – schlicht eine selbsterfüllende Prophezeiung – habe ich in der Situation nicht wahrgenommen.
Für das, was ich hätte machen müssen, nämlich mich systematischer in Gesetze und Kommentare einzuarbeiten und zu versuchen, das Feedback meiner Ausbilder genauer umzusetzen, dafür fehlte mir die Kraft und auch die Perspektive. Ob es mangelnder Fleiß oder mangelndes Durchhaltevermögen waren – ich weiß es nicht. Vermutlich war es eine Mischung aus beidem.
Mein Ausbilder versuchte damals, mir genau diese Perspektive aufzuzeigen. Ich solle die Verkrampfung in Härte, in Disziplin mir selbst gegenüber umwandeln. Jeder Patentanwalt, jede Patentanwältin sei durch diese Ausbildung gegangen, ich würde – und müsse! – das auch schaffen.
Es ist in der Branche kein Geheimnis, dass die Ausbildung eine Art Fleischwolf für das Ego ist. Man arbeite im ersten Jahr eigentlich nur für die Papiertonne, bekam ich oft zu hören. Bei allen guten Intentionen hinter dieser Aussage wurde ich jedoch nicht von dem Wissen befreit, dass ich die Kanzlei weitestgehend nur Zeit und Geld kostete. Kein sehr fruchtbarer Boden für das Entwickeln von Selbstwirksamkeit und darüber hinaus ein regelrechter Teufelskreis für Menschen wie mich, die gewisse perfektionistische Tendenzen hegen.
Es gelang weiterhin nicht, den für die Ausbildung so notwendigen Austausch in digitale Formate zu übersetzen. Blieb ich tageweise im Homeoffice – corona-bedingt, aber auch, um mir die Pendelei wenigstens hin und wieder zu ersparen – musste ich in Kauf nehmen, für meine Ausbilder nicht präsent zu sein, vom Kanzleibetrieb abgeschnitten zu sein – ein Problem in dieser doch eigentlich von Innovation lebenden Branche.
Ein wahres Damoklesschwert war für mich auch das anstehende Amtsjahr; im Februar 2022 sollte es losgehen. Erfahrungsberichte anderer Eltern in der Ausbildung und eine Petition zur Digitalisierung des Amtsjahrs brachten den Hoffnungsschimmer, es könnte vielleicht doch nicht erforderlich sein, sein Leben zu entwurzeln und für die Zeit von sechs Monaten nach München zu ziehen. Die Angst blieb, ebenso die völlige Ratlosigkeit, wie dieses halbe Jahr von mir und meiner Familie am besten gestaltet werden könnte.
Mein Abschied von der Ausbildung erfolgte in Stufen. Zunächst war ich überzeugt, nach der Ausbildung nicht in meiner ausbildenden Kanzlei bleiben zu wollen – ich hatte das Pendeln verabscheuen gelernt und im Homeoffice war ich einsam und von den Kollegen abgeschnitten. Dann suchte ich nach Lösungen, wie ich das Berufsbild für mich passender ausgestalten konnte – Netzwerken, Präsentieren und kreatives Schreiben konnten doch Teil davon werden? Sicherlich würde ich Mittel und Wege finden, ein Familienleben neben meinem Arbeitsleben zu haben?
Dann kam die erste Hagen-Klausur, corona-konform als Online-Klausur. Ich musste lernen, dass Juristen das Konzept des Folgefehlers, wie ich es als Naturwissenschaftlerin kenne, nicht anwenden. Ein kleiner, gedankenloser Fehler am Anfang kostete mich das Bestehen, und das, obwohl ich den Stoff sicher und gut beherrscht hatte. Eine Stellenanzeige in einer Patentverwertungsagentur wurde für mich dann zum Katalysator meiner Flucht.
Und wie ging es weiter?
Heute bin ich wieder in meiner kleinen Stadt, an meiner alten Uni, in einem befristeten Vertrag im Technologietransfer. Ich arbeite drei Minuten zu Fuß vom Kindergarten entfernt, jeden Tag hole oder bringe ich meinen Sohn. Ich lasse mir auf den zwanzig Minuten Fußweg nach Hause seine Erlebnisse und Gedanken schildern. Dass das nicht immer wundervoll ist, ist für jeden selbstverständlich, der Kinder um sich hat, aber ich kann im Leben meines Sohns präsent sein.
Die Ausbildung kommt für die meisten Kandidaten in einem Alter, in dem man entweder bereits Kinder hat oder welche bekommen möchte. Es ist bezeichnend, dass ich in meinem Durchgang zum Startpunkt des Studiums die einzige Frau mit Kind war. Die langen Arbeitszeiten, am besten in Präsenz, darüber hinaus das berufsbegleitende Studium und zu allem Überfluss das Amtsjahr ohne verlässliches Einkommen – das ist ein Problem für jeden, der Sorgearbeit leisten muss.
Hadere ich manchmal mit meiner Entscheidung, aufgehört zu haben? Aber sicher. Das Gespräch mit meinem Ausbilder werde ich so schnell nicht vergessen, ihn als Chef vermisse ich bis heute. Ich weiß aber heute, dass ich die Ausbildung nicht zu einem guten Ende hätte führen können. So wird es nicht nur mir gegangen sein, sondern auch vielen, die nicht die Chance haben, sich öffentlich zu dem Thema zu äußern.
In den exklusiven Klub der Patentanwälte werden diejenigen aufgenommen, die es allen Schwierigkeiten zum Trotz irgendwie geschafft haben. Ob das das Einfühlungsvermögen gegenüber Kandidaten wie mir, gegenüber Scheiternden wie mir erhöht, darf ich zumindest leise in Frage stellen.
Als Klubmitglied werde ich nicht mitspielen dürfen. Was dieses Ziel angeht, so bin ich in der Tat gescheitert. Aber es ist mir ein Anliegen zu zeigen, dass auch die äußeren Umstände meine Chronik des Scheiterns mitgeschrieben haben. Sicherlich traten diese äußeren Umstände bei mir in einer seltenen Häufung auf. Doch sie bestehen, sie haben schon immer so bestanden, und nicht nur für mich. Das ist ein Problem. Es kommt mir vermessen vor, für Euch Leser daraus eine Handlungsaufforderung abzuleiten. Einen Gedanken sollte es der Gemeinschaft der Patentanwälte dennoch wert sein.