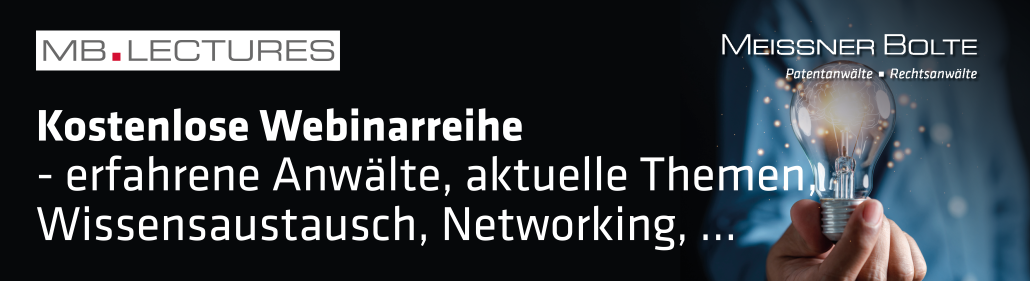So nachdem ich jetzt aus Berlin zurück bin, muss ich doch noch ein paar Bemerkungen/Fragen vorbringen

.
@Lysios,
nachdem in der von dir zitierten Entscheidung (T170/84) tatsächlich unter 4.1 steht : "
Regel 29(1) EPÜ [jetzt natürlich 43(1)] schreibt als Normalfall die zweiteilige Form für einen Patentanspruch vor", aber keinerlei Überlegungen warum dies so sein sollte, habe ich die Frage an dich, ob du mir erklären könntest, mittels welcher Auslegungsmethode die Beschwerdekammer angesichts der Formulierung des 29(1)/43(1) zu dieser Behauptung kommen konnte?
43(1) schreibt eindeutig "wo es zweckdienlich ist...", d.h. stellt eine Kondition bzw. Voraussetzung für die Folge "dann zweiteilig" auf. Wie kann man auf den Gedanken kommen, dass, wenn der Gesetzgeber etwas als "Normalfall" festlegen will, er diesen "Normalfall" mit einer Kondition aufführt, bei deren Erfüllung die Rechtsfolge (zweiteilig) eintritt ? Das setzen einer Bedingung ergäbe einen Sinn, wenn es eine allgemeine Definition wäre (etwa "eine zweiteilige Form ist dann gegeben wenn A und B erfüllt sind") oder wenn unter der Bedingung vom Normalfall gerade abgewichen werden kann/soll/darf. Es ergibt jedoch keinerlei Sinn den gewollten "Normalfall" mit einer Bedingung zu verknüpfen. Mit Ihrer Aussage, scheint die Beschwerdekammer ausdrücken zu wollen, dass der "Gesetzgeber" unlogisch handelt. Auch die Annahme, dass der Gesetzgeber eine Bedinung aufführt, die grundsätzlich gegeben ist (Annahme es wäre grundsätzlich zweckdienlich deshalb ist die zweiteilige Form der Normalfall) würde dem "Gesetzgeber" (nach meiner Logik) fehlende Fähigkeiten unterstellen (weil grundsätzlich erfüllte Bedingungen haben in einem "Gesetz" erstmal nichts zu suchen).
Also kannst du mir da weiterhelfen, ob die das sprachlich/systematisch/historisch/teleologisch hinbekommen haben könnten? Mir fällt beim besten Willen keine Möglichkeit ein, wie man bei der Formulierung des 29(1)/43(1) zu der Auslegung kommen kann, dass die zweiteilige Form der "Normalfall" ist. Im Gegenteil logisch drückt diese gerade aus, dass die einteilige Form der "Normalfall" ist, von der beim Erfüllen einer Bedinung ("wo zweckdienlich") abzuweichen ist, aber auch nur dann. Und diese Bedingung wäre dann, wenn das EPA die zweiteilige Form einfordern will, auch vom EPA zu beweisen und nicht umgekehrt, dass der Anmelder "beweisen" muss, dass die zweiteilge Form nicht zweckdienlich wäre.
Außer dass ich es so gelernt habe, dass man Ansprüche einteilig schreibt, habe ich auch sehr häufig bei der Überlegung Schwierigkeiten (ja ich überlege mir manchmal wie der Anspruch jetzt zweiteilig aussehen könnte

), welches Merkmal denn nun aus einem SdT bekannt ist und welches nicht. Gerade wenn der Prüfer mal wieder großzügig/breit auslegt, was ein Merkmal A bedeutet, führt das häufig bei mir zu dem Effekt, dass man in einer ersten (breiten) Auslegung ein Merkmal A im SdT noch als offenbart ansehen kann, durch spätere Merkmale B,C des Anspruchs führt diese (breite) Auslegung von A dann aber zu Widersprüchen, d.h. es stellt sich heraus, weil es auch noch ein Merkmal B gibt, kann man die erste (breite) Auslegung von A nicht "halten", aber nur weil es das Merkmal B gibt (das nicht unmittelbar auf Merkmal A Bezug nehmen muss). Gehört dann das Merkmal A in den Oberbegriff, weil das ist ja in einer (breiten) Auslegung im SdT offenbart ist, oder in den kennzeichnenden Teil, weil diese (breite) Auslegung von A ja für den gesamten Anspruch nicht "durchzuhalten" ist?
Und zu deiner "Beruhigung"

. In mehr als 20 Jahren in dem Beruf ist mir noch NIE der Fall untergekommen, dass der Prüfer eine 71(3) nur deshalb "verweigert" hat, weil es keine zweiteilige Form gab ;-). Als "Äußertes" gab es die 71(3) mit einer zweiteiligen Fassung des unabhängigen Anspruchs

. Das Verwenden einer einteiligen Form führt also nicht zu einer Verlängerung des Erteilungsprozesses ;-). Und zu deiner früheren Aussage, dass dir nur selten EP-Patente mit einteiligen Ansprüchen unterkommen würden, dann kann das einerseits mit schon von dir angedeuteten Unterschieden in Gebieten zusammenhängen (ich kenne deins ja nicht und du womöglich meins auch nicht

) oder (für mich wahrscheinlicher) damit dass viele Anwälte womöglich genauso denken wie du, dass sie in einem (für mich) vorauseilenden "Gehorsam" die zweiteilige Form unnötigerweise einführen bzw. von (ur)alten Patentanwälten ausgebildet wurden, die die zweiteilige Form meist eher "toll" finden. Es gibt aber Anwälte, die das nicht machen und damit regelmäßig einteilige Ansprüche erteilt bekommen. Ich habe gerade (zum Spaß) mal nach ein paar Patenten eines früheren Mandanten nachgeschaut und siehe da, praktisch alle, die ich mir angeschaut habe (gibt es eigentlich eine leichte Methode sich nur die erteilten EP-Patente eines Anmelders in Espacenet anzeigen zu lassen?), haben die einteilige Form und das einzige das die zweitelige Anspruchsform hat, ist genau ein solches, in dem der Prüfer die zweiteilige Form in der 71(3) eingefügt hat (ja daraufhin habe ich mir das Patent extra auch noch in der Onlineakte angeschaut, weil mich das gewundert hat)

.
Und noch zu §9PatV. Wo würde ein Anspruch:
1. Vorrichtung, die die Merkmale A+B+C+D aufweist. Zusätzlich weist die (oder alternativ muss die...) Vorrichtung noch die Merkmale E+F auf.
denn dem §9PatV zuwiderlaufen? Ein solcher Anspruch wäre wohl sehr unüblich. Aber wieso widerspricht ein solcher Anspruch jeder Interpretation ("
gar nicht anders interpretieren") des §9PatV?
@Pat-Ente
Vielleicht mal eine Anregung zum Grübeln für dich ;-).
Wenn dir bei Verfahrensansprüchen häufiger passiert, dass du nach dem Schritt, der dir die erfinderische Tätigkeit "begründet", noch weitere Schritte im Anspruch hast, dann solltest du womöglich mal drüber nachdenken, was diese weiteren Schritte im Anspruch denn noch machen, wenn das Verfahren doch ohne diese nachfolgenden Schritte schon erfinderisch ist ;-) ? Vielleicht könnte man die dann einfach weglassen (und ein anderes Verfahren draus machen) ;-) ?
Nur meine Gedanken dazu ;-).