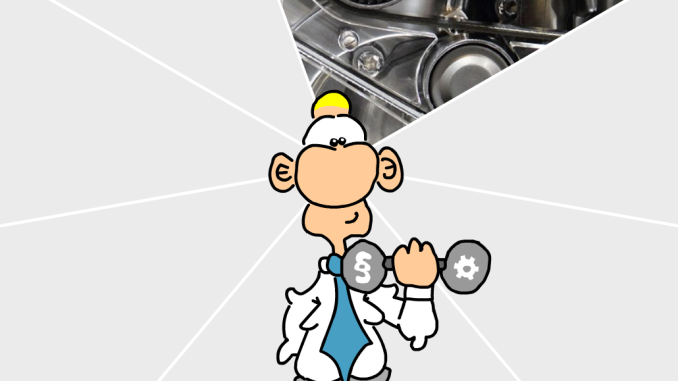
Teil 2: Erfinder versus Anmelder
Der Erfinder ist der Eigentümer seiner Erfindung. Der Anmelder ist diejenige natürliche oder juristische Person, die die Erfindung zum Patent anmeldet. Erfinder und Anmelder können dieselbe Person sein. Alternativ kann der Erfinder seine Erfindung durch Vertrag an eine natürliche Person oder eine Organisation übertragen, die dann rechtmäßig die Erfindung zum Patent anmelden kann. Außerdem ergibt sich aus dem Arbeitnehmererfindungsrecht, dass der Arbeitgeber die Rechte an der Erfindung seines erfinderischen Arbeitnehmers in Anspruch nehmen kann.
Alle Artikel zur Artikelserie „Einführung in das Patentrecht“:
Teil 1: Erfindung, Patentanmeldung und Patent
Teil 2: Erfinder versus Anmelder
Teil 3: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
Teil 4: Erteilungsverfahren
Teil 5: Einspruch
Teil 6: Nichtigkeit
Teil 7: Beschwerde, Rechtsbeschwerde und Berufung
Teil 8: Wirkung und Grenzen des Patentschutzes
Teil 9: Verletzungsverfahren
1. Erfinderprinzip
Das Erfinderprinzip, das erst mit der Reform des Patentgesetzes 1936 realisiert wurde, erlaubt keine sogenannten „Betriebserfindungen“, denen kein Erfinder zugeordnet wird. Vor 1936 wurde mit „Betriebserfindungen“ Missbrauch betrieben und die Erfinder um ihre Erfinderehre gebracht.[1] Der §6 Satz 1 Patentgesetz setzt das Erfinderprinzip um und bestimmt, dass für eine patentfähige Erfindung eine natürliche Person als Erfinder eine Voraussetzung ist.
2. Anmelder
Der Anmelder ist diejenige natürliche oder juristische Person, die die Erfindung zum Patent anmeldet. Ein Anmelder ist nur berechtigt zur Anmeldung einer Erfindung, falls er der Erfinder ist oder falls die Erfindung zuvor auf ihn übertragen wurde. Eine Übertragung kann durch Vertrag, durch Erbe oder als Arbeitgeber des Erfinders erfolgen. Damit das Verfahren vor dem Patentamt nicht verzögert wird, geht das Patentamt zunächst von der Berechtigung des Anmelders aus.[2] Allerdings muss der Anmelder innerhalb von fünfzehn Monaten nach dem Anmeldetag den Erfinder benennen und angeben, wie das Recht von dem Erfinder auf ihn übergegangen ist, falls er nicht der Erfinder ist.[3] Die Angaben des Anmelders werden vom Patentamt nicht überprüft.[4]
Auch für ein Gebrauchsmuster gilt das Erfinderprinzip. Ein Anmelder eines Gebrauchsmusters, der nicht der Erfinder ist, muss daher das Recht vom Erfinder übertragen bekommen haben. Ansonsten liegt eine Anmeldung eines Unberechtigten vor. Eine Nennung des Erfinders in der Gebrauchsmusterschrift sieht das Gebrauchsmustergesetz dennoch nicht vor.
3. Anmelder als Arbeitgeber
Ist der Erfinder ein Arbeitnehmer, so steht seinem Arbeitgeber das Recht an der Erfindung zu. Nach §6 Absatz 1 Arbeitnehmererfindungsgesetz kann der Arbeitgeber durch Erklärung gegenüber seinem Arbeitnehmer dessen Erfindung in Anspruch nehmen. Durch die Inanspruchnahme gehen sämtliche vermögenswerten Rechte auf den Arbeitgeber über.[5] Eine Erklärung des Arbeitgebers wird fingiert, falls der Arbeitgeber nicht innerhalb von vier Monaten nach Erfindungsmeldung die Erfindung freigibt.[6]
Kein Recht auf Inanspruchnahme durch den Arbeitgeber besteht, falls es sich bei der Erfindung des Arbeitnehmers um eine freie Erfindung handelt. Eine freie Erfindung ist nicht aus der beruflichen Tätigkeit des Arbeitnehmers entstanden und beruht auch nicht auf dem betrieblichen Know-How.[7]
4. Widerrechtliche Entnahme
Eine widerrechtliche Entnahme wird alternativ als Vindikation bezeichnet und bedeutet insbesondere die Anmeldung einer Erfindung durch einen unberechtigten Anmelder. Nach §8 Satz 1 Patentgesetz kann der Berechtigte von dem unberechtigten Anmelder verlangen, dass ihm die Anmeldung übertragen wird. Führte die Anmeldung bereits zu einem Patent, kann vom Patentinhaber die Übertragung des Patents gefordert werden.
Der Berechtigte kann seine Rechte durch einen Einspruch oder eine Nichtigkeitsklage durchsetzen. Durch einen Einspruch gemäß §59 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. §21 Absatz 1 Nr. 3 Patentgesetz oder eine Nichtigkeitsklage gemäß §81 Absatz 1 Satz 1 i.V.m. §§22, 21 Absatz 1 Nr. 3 Patentgesetz kann der Berechtigte das widerrechtlich erworbene Patent für nichtig erklären lassen. Alternativ kann eine Vindikationsklage nach §8 Patentgesetz erhoben werden.
[1] Mediger, GRUR 1952, 67.
[2] §7 Absatz 1 Patentgesetz.
[3] §37 Absatz 1 Satz 1 Patentgesetz.
[4] §37 Absatz 1 Satz 3 Patentgesetz.
[5] §7 Absatz 1 Arbeitnehmererfindungsgesetz.
[6] §6 Absatz 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz.
[7] §4 Absatz 3 i.V.m. §4 Absatz 2 Arbeitnehmererfindungsgesetz.



