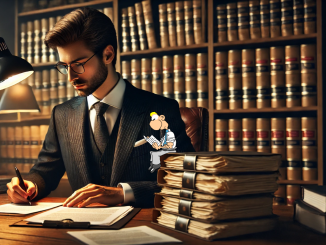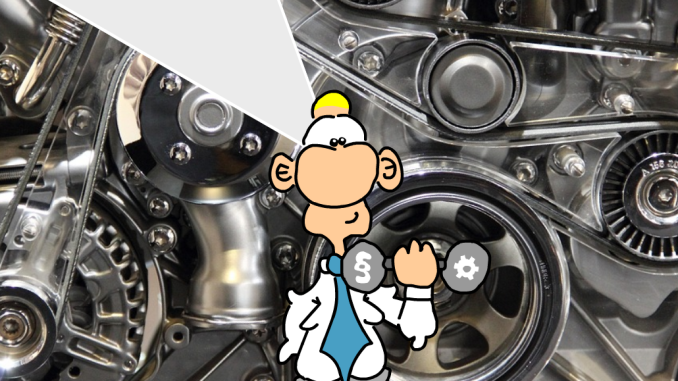
Teil 8: Wirkung und Grenzen des Patentschutzes
Bei einer drohenden Erstbegehung einer Patentverletzung oder im Wiederholungsfalle steht dem Patentinhaber ein Unterlassungsanspruch zu. Liegt Verschulden vor, was in aller Regel der Fall ist, kann außerdem Schadensersatz für die begangene Patentverletzung verlangt werden.
Alle Artikel zur Artikelserie „Einführung in das Patentrecht“:
Teil 1: Erfindung, Patentanmeldung und Patent
Teil 2: Erfinder versus Anmelder
Teil 3: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
Teil 4: Erteilungsverfahren
Teil 5: Einspruch
Teil 6: Nichtigkeit
Teil 7: Beschwerde, Rechtsbeschwerde und Berufung
Teil 8: Wirkung und Grenzen des Patentschutzes
Teil 9: Verletzungsverfahren
1. Unterlassungsanspruch
Aus dem § 139 Absatz 1 Satz 1 Patentgesetz ergibt sich der Unterlassungsanspruch des Patentinhabers, mit dem die Rechte aus den §§ 9 und 10 Patentgesetz durchgesetzt werden können.
Der Unterlassungsanspruch besteht bei einer unmittelbaren Patentverletzung nach §9 Patentgesetz oder einer mittelbaren Patentverletzung nach §10 Patentgesetz, und zwar bereits wenn eine Erstbegehung einer Patentverletzung zu besorgen ist. Ein Verschulden ist nicht erforderlich, es sei denn, es liegt eine mittelbare Patentverletzung vor.
2. Sonstige Ansprüche
Ein Schadensersatzanspruch kann nach § 139 Absatz 2 Satz 1 Patentgesetz bei Vorsatz oder Fahrlässigkeit, wovon in aller Regel auszugehen ist, geltend gemacht werden. Außerdem bestehen nach den §§ 140a und 140b Patentgesetz Vernichtungs-, Auskunfts- und Rückrufansprüche.
Der Patentinhaber kann einen Rückruf patentverletzender Produkte verlangen, um diese Produkte endgültig aus dem Vertriebsweg zu entfernen.[1] Gemäß §140b Absatz 1 Patentgesetz kann zusätzlich Auskunft über die Vertriebswege und die Herkunft der patentverletzenden Produkte verlangt werden.
Hat der Verletzer unter Benutzung des Patents auf Kosten des Patentinhabers etwas erlangt, kann der Patentinhaber dies vom Verletzer nach § 812 Absatz 1 Satz 1 BGBherausverlangen.
3. Anspruchsberechtigung
Die Ansprüche aus einem Patent kann der Patentinhaber und ein exklusiver Lizenznehmer einfordern. Ein einfacher Lizenznehmer ist kein Anspruchsberechtigter, es sei denn, es liegt eine Aktivlegitimierung in Form einer gewillkürten Prozessstandschaft vor.[2]
4. Grenzen des Patentschutzes
In §11 Patentgesetz werden die Grenzen des Patentschutzes aufgezählt. Insbesondere eine private Nutzung des Gegenstands des Patents ist stets außerhalb des Schutzumfangs.[3] Eine Einzelzubereitung eines Medikaments durch einen Apotheker wird ebenfalls nicht durch einen Patentanspruch erfasst.[4]
Das Versuchsprivileg nach §11 Nr. 2 Patentgesetz erlaubt ungeachtet eines bestehenden Patents Versuche zur Untersuchung des Gegenstands des Patents. Dienen die Versuche jedoch nicht der Erforschung der technischen Lehre des Patents, werden die Versuche nicht vom Versuchsprivileg gedeckt und können vom Patentinhaber verboten werden.[5]
Nach §12 Absatz 1 Satz 1 Patentgesetz besteht ein Vorbenutzungsrecht für denjenigen, der zum Zeitpunkt der Anmeldung die Erfindung benutzte oder zumindest die erforderlichen Vorbereitungen dazu unternommen hat. Nimmt das Patent eine Priorität in Anspruch gilt ein Vorbenutzungsrecht nur für solche patentierten technischen Lehren, die bereits vor dem Prioritätstag in Benutzung waren oder deren Benutzung ernsthaft vorbereitet wurden.[6]
[1] § 140a Absatz 3 Satz 1 Patentgesetz.
[2] Mes, 5. Aufl. 2020, PatG § 139 Rn. 44-51; Osterrieth, Teil 6. Patentverletzung Osterrieth, Patentrecht, 6. Auflage 2021, Rn. 927.
[3] § 11 Nr. 1 Patentgesetz.
[4] § 11 Nr. 3 Patentgesetz.
[5] BGH 11.7.1995 – X ZR 99/92, GRUR 1996, 109 – Klinische Versuche I; BGH 17.4.1997 – X ZR 68/94, NJW 1997, 3092 – Klinische Versuche II.
[6] § 12 Absatz 2 Satz 1 Patentgesetz.