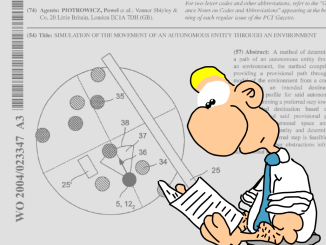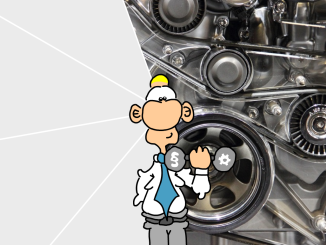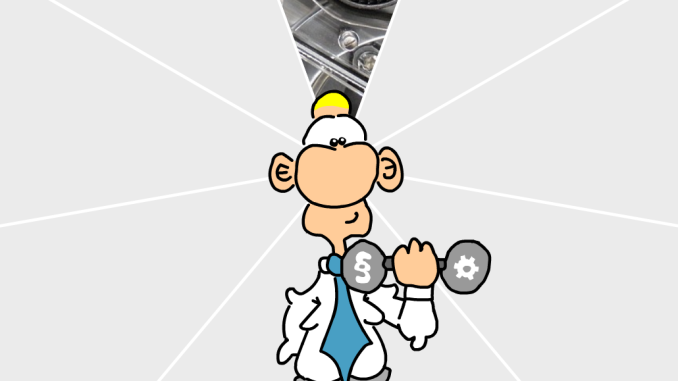
Teil 1: Erfindung, Patentanmeldung und Patent
Im Patentrecht kann zwischen der Erfindung, einer Patentanmeldung und dem erteilten Patent unterschieden werden. Eine Erfindung kann zum Patent angemeldet werden. Erfüllt die Erfindung die Patentierungsvoraussetzungen wird sie erteilt, woraus sich ein Verbietungsrecht ergibt.
1. Erfindung
Im Patentgesetz ist nicht definiert, was eine Erfindung ist. Es handelt sich bei dem Begriff der Erfindung um einen unbestimmten Rechtsbegriff. Der Gesetzgeber hat hier nichts vergessen, sondern bewusst eine Lücke gelassen, die von der Rechtspraxis, insbesondere der Rechtsprechung, zu schließen ist. Hierdurch kann der Begriff der Erfindung an die jeweils vorherrschende Interpretation angepasst und damit das Patentgesetz den aktuellen Bedürfnissen gerecht werden.
Alle Artikel zur Artikelserie „Einführung in das Patentrecht“:
Teil 1: Erfindung, Patentanmeldung und Patent
Teil 2: Erfinder versus Anmelder
Teil 3: Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit
Teil 4: Erteilungsverfahren
Teil 5: Einspruch
Teil 6: Nichtigkeit
Teil 7: Beschwerde, Rechtsbeschwerde und Berufung
Teil 8: Wirkung und Grenzen des Patentschutzes
Teil 9: Verletzungsverfahren
Das Patentgesetz ist nur technischen Erfindungen zugänglich.[1] Ästhetische Formschöpfungen sind beispielsweise nach §1 Absatz 3 Nr. 2 Patentgesetz vom Patentschutz explizit ausgeschlossen. Für diese kann rechtlicher Schutz nach dem Designgesetz erlangt werden. Eine Erfindung gilt als technisch, wenn sie mit planmäßigem Handeln beherrschbare Naturkräfte nutzt, um reproduzierbar einen kausal übersehbaren Erfolg zu erzielen.[2]
Das Patentgesetz schließt reine Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden, Pläne und Regeln für Spiele und geschäftliche Tätigkeiten explizit vom Patentschutz aus.[3] Geschäftsmodelle sind daher nicht patentfähig. Außerdem kann für Software kein Patent erlangt werden. Dies gilt jedoch nur für „Software als solche“.[4] Weist eine Software einen technischen Charakter auf, kann sie zu einem Patent führen.
Verfahren zur chirurgischen oder therapeutischen Behandlung von Menschen oder Tieren können außerdem nicht patentiert werden.[5]
2. Patentanmeldung
Eine Erfindung kann zum Patent angemeldet werden.[6] Der Anmeldung wird ein Anmeldetag zuerkannt, falls der Name des Anmelders, ein Antrag auf Erteilung des Patents und eine Beschreibung der Erfindung in den Anmeldeunterlagen enthalten sind.[7] Nach §34 Absatz 3 Nr. 3 und 5 kann die Anmeldung zusätzlich Patentansprüche und Zeichnungen umfassen.
Eine Patentanmeldung gibt dem Anmelder kein Ausschließlichkeitsrecht. Vielmehr ist es jedermann grundsätzlich erlaubt, die technische Lehre einer Patentanmeldung zu nutzen. Allerdings erwirbt der Anmelder gegenüber demjenigen, der die angemeldete Erfindung nutzt, einen Entschädigungsanspruch.[8] Der Entschädigungsanspruch entspricht nicht dem Schadensersatz nach Patentverletzung und ist üblicherweise deutlich niedriger.[9]
3. Patent
Ist der Gegenstand der Patentanmeldung neu, erfinderisch und gewerblich anwendbar, kann in einem Erteilungsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt eine Patenterteilung erreicht werden.[10]
Ein Patent stellt ein Verbietungsrecht dar. Grundsätzlich kann mit einem Patent jede Form der Benutzung der geschützten Erfindung verhindert werden. Wird durch das Patent eine Vorrichtung geschützt, so kann der Patentinhaber das Herstellen, das Anbieten und das Inverkehrbringen der Vorrichtung verbieten.[11]
Der Patentinhaber kann zusätzlich oder alternativ eine mittelbare Patentverletzung geltend machen, bei der sich ein Verbietungsrecht auf wesentliche Elemente der patentgeschützten Erfindung bezieht, falls diese Mittel zur Benutzung der Erfindung geeignet sind. Außerdem muss die Eignung dem Verletzer bekannt oder zumindest offensichtlich gewesen sein. Bei einer mittelbaren Patentverletzung kann nur das Anbieten und Liefern im Inland geltend gemacht werden. Eine Herstellung stellt beispielsweise keine mittelbare Patentverletzung dar.[12] Mit der mittelbaren Patentverletzung kann der Patentinhaber mit einem einzelnen Verfahren gegen einen Lieferanten eines wesentlichen Elements der Erfindung eine Vielzahl von Patentverletzungsverfahren wegen unmittelbarer Patentverletzung vermeiden. Der Gesetzgeber wollte es dem Patentinhaber ermöglichen, das „Übel der Patentverletzung an der Wurzel zu packen“.[13]
[1] §1 Absatz 1 Patentgesetz.
[2] BGH Beschluss vom 27. März 1969, X ZB 15/67 – Rote Taube; BGH Beschluss vom 22. Juni 1976, X ZB 23/74 – Dispositionsprogramm; BGH Beschluss vom 16. September 1980, X ZB 6/80 – Walzstabteilung.
[3] §1 Absatz 3 Nr. 3 Patentgesetz.
[4] §1 Absatz 4 Patentgesetz.
[5] §2a Absatz 1 Nr. 2 Patentgesetz.
[6] §34 Absatz 1 Patentgesetz.
[7] §35 Absatz 1 i.V.m. §34 Absatz 3 Nr. 1, 2 und 4 Patentgesetz.
[8] §33 Absatz 1 Patentgesetz
[9] §139 Absatz 2 Satz 1 Patentgesetz.
[10] §1 Absatz 1 Patentgesetz.
[11] §9 Nr. 1 Patentgesetz.
[12] §10 Absatz 1 Patentgesetz.
[13] Mes, Die mittelbare Patentverletzung GRUR 1998, 281.