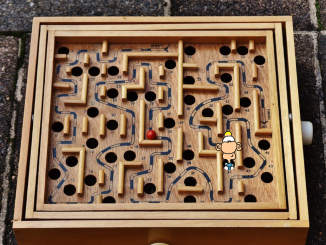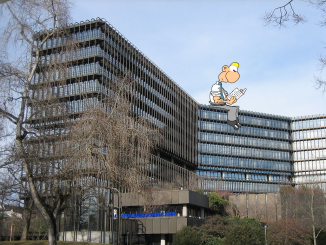Kaum eine andere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) wurde außerhalb Deutschlands, ja sogar außerhalb Europas, mit so großer Spannung erwartet wie die des 2. Senats des BVerfG im Fall 2 BvR 739/17 über die Beschwerde gegen das Gesetz zur Ratifikation des Übereinkommens über ein Einheitliches Patentgericht (EPGÜ). In den meisten Kommentaren liegt das Hauptaugenmerk auf dem Ergebnis des Falls: Das Gesetz wurde für nichtig erklärt, da es nicht durch die vom BVerfG als notwendig erachtete Zweidrittelmehrheit der Bundestagsabgeordneten beschlossen worden war. Im Folgenden wird die Bedeutung der Begründung des BVerfG für die Zukunft des EPGSystems (sofern es eine Zukunft hat) analysiert.
Grundsätze hinter und Bedeutung der Begründung des BVerfG
Viele Stimmen aus der IP-Welt scheinen den Mangel im Ratifikationsverfahren (Fehlen der Zweidrittelmehrheit) als unbedeutende Formalie zu betrachten, die leicht behoben werden könnte und daher nicht allzu viel Aufmerksamkeit verdient.
Doch aus verfassungsrechtlicher Sicht handelt es sich um eine Grundsatzentscheidung: Sie betrifft die recht sensiblen Fragen, auf welche Weise und in welchem Ausmaß materielle Verfassungsänderungen im Weg der internationalen Zusammenarbeit, insbesondere zum Zweck der europäischen Integration, möglich sind.
Das BVerfG hat sich intensiv mit der Frage befasst, ob die Übertragung von Hoheitsrechten auf das Einheitliche Patentgericht (EPG), die gemäß Artikel 23 Absatz 1 Satz 2 Grundgesetz (GG) grundsätzlich möglich ist, das Grundgesetz inhaltlich geändert oder ergänzt hat. Ist das der Fall, ist laut Art. 23 Abs. 1 Satz 3 GG in Verbindung mit Art. 79 Abs. 2 GG die genannte Zweidrittelmehrheit erforderlich.
Innerhalb des 2. Senats war streitig, ob eine Verpflichtung in einem völkerrechtlichen Vertrag, der deutsche Bürger Akten einer internationalen Behörde unterwirft, vor Inkrafttreten des die Befugnisse übertragenden Gesetzes die Grundlage einer Verfassungsbeschwerde einer Einzelperson sein kann. Eine Mehrheit von 5:3 Richtern bejahte dies und vertrat die Auffassung, dass jedwede Übertragung von gerichtlichen Funktionen auf einen internationalen Spruchkörper die im Grundgesetz vorgesehene Zuordnung gerichtlicher Zuständigkeiten ändere und insoweit eine materiellrechtliche Änderung der Verfassung darstelle. In diesem Zusammenhang erkannte das BVerfG den Anspruch eines Bürgers auf Überprüfung der formellen Erfordernisse des Übertragungsgesetzes an mit dem Argument, einem anderen Völkerrechtssubjekt übertragene Befugnisse seien üblicherweise „verloren“ und könnten vom Gesetzgeber nicht ohne Weiteres wiedererlangt werden.
Nach der Ansicht der Mehrheit der Richter des Senats ist das in Art. 38 GG niedergelegte demokratische Prinzip die rechtliche Grundlage für diese Herangehensweise.
Es gewährt dem Bürger den Anspruch darauf, dass Hoheitsrechte nur in den im Grundgesetz vorgesehenen Formen übertragen werden.
Nur eine Formalie oder größere Relevanz für die Zukunft des EPG?
Neben diesem formellen Angriff stützte sich die Verfassungsbeschwerde auf drei weitere Gründe:
- Die Stellung der Richter des EPG entspreche nicht der Rechtsstaatlichkeit;
- Handlungen des EPG, die Grundrechte berührten, fehle es an demokratischer Legitimation; und
- Das EPGÜ verstoße gegen Unionsrecht.
Das BVerfG entschied, dass die Beschwerde in all diesen Punkten unzulässig sei.
Doch der Teufel steckt im Detail der Begründung: Im Grundsatz entschied das BVerfG, dass der Beschwerdeführer nicht dargelegt habe, dass Rechte aus dem demokratischen Prinzip in seinem Fall konkret verletzt worden waren. Großteils sah das BVerfG keinen Zusammenhang zwischen dem demokratischen Prinzip als anwendbarem Prüfungsmaßstab im vorliegenden Verfahren und anderen Verfassungsgrundsätzen wie dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip.
Konkret entschied das BVerfG bezüglich des Ernennungsverfahrens der Richter und deren demokratischer Legitimation, dass die Gründe der Verfassungsbeschwerde nicht die konkrete Wirkung aufzeigten, die ein mit anderen Ländern auszuhandelnder Vertrag auf Deutschlands Teilnahme an dem internationalen Gericht habe. Was die Befugnisse des Verwaltungsausschusses anbelangt, stellte das BVerfG fest, dass der Verweis des Beschwerdeführers auf die BVerfG-Entscheidung zum CETA-Handelsabkommen mit Kanada nicht verfange, da Deutschland bei der Teilhabe an Entscheidungen des Ausschusses gleichberechtigt sei. Außerdem bemerkte das BVerfG, dass der angebliche Verstoß gegen Unionsrecht keinen Verstoß gegen das demokratische Prinzip begründen könne und dass das Unionsrecht keine formellen oder materiellen Voraussetzungen enthalte, welche die Gültigkeit eines deutschen Gesetzes in Zweifel ziehen oder gar die Identität der deutschen Verfassung verändern könne. Der Grundsatz der Europarechtsfreundlichkeit ändere an dieser Schlussfolgerung nichts, da dieser Grundsatz nach der Rechtsprechung des BVerfG nicht zur Folge habe, dass das Unionsrecht zum Prüfungsmaßstab für deutsches Recht werde. Das Gericht lässt indes offen, ob im Hinblick auf die in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union geregelten Grundrechte etwas Anderes gelten könnte, wenn im Rahmen der europäischen Integration eine Rechtsfrage ausschließlich durch Unionsrecht geregelt sei.
Einerseits ist das EPG eine eigenständige internationale Einrichtung außerhalb des Unionsrechts. Andererseits muss das EPG Unionsrecht anwenden und gemäß Artikeln 20 und 24 Abs. 1 EPGÜ dessen Vorrang anerkennen. Beispiele hierfür sind die zwei Verordnungen zum Einheitspatent, die Biotechnologie-Richtlinie und die Durchsetzungsrichtlinie. In diesem Zusammenhang hat der letzte Absatz der Entscheidung zu vielen Spekulationen geführt. Dort stellte das BVerfG fest, dass ein bedingungsloses Primat des Unionsrechts gegen das Grundgesetz verstoßen könnte. Die im Zusammenhang mit dieser Feststellung zitierte Entscheidung stellt klar, dass die Geltendmachung eines Verstoßes gegen das demokratische Prinzip als Begründung für eine Verfassungsbeschwerde zu der Prüfung führen kann, ob die zu überprüfende Maßnahme mit dem in Art. 20 Abs. 1 und 2 GG festgeschriebenen Rechtsstaatlichkeitsprinzip in Einklang steht.
Das heißt: Die Kommentare, die aus der Begründung des BVerfG abgeleitet haben, dass die materiellrechtlichen Angriffe der Beschwerde für die Zukunft des EPG bedeutungslos geworden sind, sind schlichtweg unzutreffend. Das BVerfG hat diese Angriffe ganz eindeutig lediglich im Hinblick auf den eingeschränkten Prüfungsmaßstab geprüft, der in der vorliegenden, noch während eines laufenden Gesetzgebungsverfahrens von einer Einzelperson angestrengten, Verfassungsbeschwerde anwendbar ist. Der Prüfungsmaßstab bei einer (möglichen nachfolgenden) Verfassungsbeschwerde wegen einer Verletzung des Rechts einer Partei durch das EPG ist viel umfassender. Dies ist beispielsweise aus der Entscheidung 2 BvR 1961/09 vom 24. Juli 2018 zum wirkungsvollen Rechtsschutz gegen Akte einer der Europäischen Schulen, die eine eigenständige internationale Organisation bilden, ersichtlich. Grundsätzlich erklärte das BVerfG, dass internationale Organisationen Grundrechtsschutz gewährleisten müssen, der den Mindeststandard des Grundgesetzes wahrt, und insbesondere dessen Wesensgehalt, speziell die Einhaltung des Rechtsstaatsprinzips, garantieren muss. Die Garantie des wirksamen Rechtsschutzes schließt den Zugang zu unabhängigen Gerichten ein, der nicht faktisch unmöglich oder in unzumutbarer Weise erschwert sein darf. Das BVerfG betonte, dass die Grundrechte nicht nur bei der Übertragung von Hoheitsrechten, sondern auch bei deren Ausübung, geachtet werden müssen. Zusammenfassend bedeutet dies, dass verfassungswidrige Praktiken des EPG der Prüfung durch das BVerfG unterlägen.
Einen ersten Hinweis darauf, wie die obenstehenden Grundsätze durch das BVerfG angewandt werden, können die vier anhängigen Fälle gegen das angeblich unzureichende System der richterlichen Überprüfung vor den Beschwerdekammern des EPA liefern. Diese Fälle stehen in der Jahresvorschau des Gerichts für 2020. Der Berichterstatter ist derselbe wie im EPG-Fall. Das Ergebnis dieser Fälle ist unter Umständen nicht nur für den Prüfungsmaßstab relevant, der bei zukünftigen Verfassungsbeschwerden gegen Entscheidungen des EPG zu erwarten ist. Vielmehr könnte es das System des Einheitspatentsystem unmittelbar berühren, da die Beschwerdekammern in dieses System integriert und darin für den endgültigen Widerruf von Einheitspatenten in Einspruchsbeschwerdeverfahren zuständig sind.
EPG-System muss ohnehin geändert werden
Unabhängig davon kann das System ohnehin nicht unverändert bleiben. Der offensichtlichste Grund dafür ist die Vorschrift in Artikel 7 Abs. 2 EPGÜ, nach der eine Abteilung der Zentralkammer des EPG ihren Sitz in London hat. Nach einhelliger Meinung scheint dies mit der Tatsache unvereinbar ist, dass das Vereinigte Königreich kein Vertragsstaat des EPGÜ mehr sein wird. Deshalb ist die entscheidende Frage für die Zukunft des EPG, ob es nach wie vor den politischen Willen für einen Plan B, also ein System ohne das Vereinigte Königreich, gibt. Es gibt sicher gute Gründe für den Plan B:
Auf der Patentanmeldungsebene zählen wegen des Wegfallens noch bestehenden Validierungsbestimmungen erhebliche Kosteneinsparungen, vorteilhafte Verwaltungsgebühren (die an den Brexit anzupassen sind, was politische Fragestellungen aufwerfen könnte) und gleichzeitig ein breiter geographischer Schutzbereich zu den Hauptvorteilen. Auf Patentstreitebene ist das Vermeiden von kostspieligen und zeitaufwändigen Parallelprozessen in mehreren europäischen Ländern, also die Möglichkeit, in einem einzigen Verfahren vor einem einzigen Gericht eine quasi unionsweit gültige Gerichtsentscheidung zu erhalten, der Hauptvorteil.
Hier nun die aktuellen Äußerungen einiger Hauptakteure zu den Perspektiven:
Im Hinblick auf das weitere Vorgehen führte der Vorsitzende des Vorbereitenden Ausschusses, Alexander Ramsay, aus:
„Once Germany will be in a position to ratify the UPC Agreement and the Protocol on the Provisional Application, arrangements will be made to deal with the practical implications of the UK’s departure.“
Die Justizministerin nährte, sehr zur Überraschung einiger Beobachter, die Hoffnung auf einen baldigen Abschluss des deutschen Ratifikationsverfahrens, indem sie mitteilte:
„Ich werde mich auch weiterhin dafür einsetzen, dass wir der europäischen innovativen Industrie ein einheitliches europäisches Patent mit einem europäischen Patentgericht zur Verfügung stellen können. Die Bundesregierung wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sorgfältig auswerten und Möglichkeiten prüfen, um den festgestellten Formmangel noch in dieser Legislaturperiode zu beheben.“
Der Präsident des EPA hieß die deutsche Ankündigung willkommen und erklärte sie stelle klar, dass eine Zustimmung zum EPGÜ durch die erforderliche Mehrheit im Bundestag nach wie vor möglich ist.
Diese Aussagen sind vor dem folgenden Hintergrund interessant: Der Vorbereitende Ausschuss war zwar immer sehr optimistisch, was das Verkünden der unmittelbar bevorstehenden Umsetzung des Systems angeht; doch die Justizministerin war vor ungefähr einem halben Jahr noch bedeutend zurückhaltender, als sie erklärte, dass die tatsächlichen und rechtlichen Konsequenzen eines Ausstiegs des Vereinigten Königreichs aus dem EPGÜ auf europäischer Ebene geprüft und koordiniert werden müsse, bevor der Ratifikationsprozess abgeschlossen werden könne.
Nun, da das Vereinigte Königreich seinen Rückzug aus dem EPGÜ angekündigt hat, sind die tatsächlichen und rechtlichen Konsequenzen des Brexits in Bezug auf das EPGÜ nach wie vor nicht klar. Tatsächlich gibt es ernsthafte Zweifel, ob überzeugende Lösungen für eine Reihe von Problemen innerhalb der aktuellen Legislaturperiode, also vor dem Herbst 2021, gefunden werden können. Was es zu klären gilt, sind nicht nur praktische Auswirkungen des Rückzugs des Vereinigten Königreichs, sondern rechtlich umsetzbare Wege, wie das EPGÜ an die geänderten Umstände angepasst werden kann. Artikel 87 EPGÜ ist darauf nicht zugeschnitten. Zwar räumen Absatz 1 und 2 dem Verwaltungsrat gewisse Kompetenzen zur Revision des Übereinkommens ein, aber frühestens sieben Jahre nach dessen Inkrafttreten und um das Übereinkommen mit internationalen Verträgen oder EU-Recht in Einklang zu bringen. Ersteres ist nicht einschlägig und bei zweiterem lässt sich trefflich darüber streiten, ob eine Vorschrift zur Revision eines Vertragswerks dazu genutzt werden kann, den Vertrag überhaupt in Kraft zu setzen. Da die Entscheidungen des Gerichts in allen teilnehmenden Staaten vollstreckbar sein sollen, sollte das EPG nur auf einer Rechtsgrundlage geschaffen werden, die nicht in Zweifel gezogen werden kann.
Unabhängig davon kann jeder Vertragsstaat eine Änderung nach Artikel 87 Absatz 1 bzw. 2 blockieren, indem er sich nach Absatz 3 für nicht gebunden erklärt. Faktisch besteht also ein Erfordernis der Einstimmigkeit für jede Änderung durch den Verwaltungsrat. Hier ist ein Hauen und Stechen zu erwarten, wer London als Sitz einer Abteilung der Zentralkammer beerben wird.
Mailand hat als erstes seinen Hut in den Ring geworfen, Italien hat allerdings seine Position nicht gerade dadurch gestärkt, dass die Regierung offenbar Turin favorisiert. Andere Stimmen sprechen sich dafür aus, die Gelegenheit zu nutzen, um die Zentralkammer insgesamt in Paris zusammenzufassen und auch die Niederlande sind im Gespräch. Mit weiteren Prätendenten kann gerechnet werden. Nahliegend wäre es auch, den Standort in dem Land zu stärken, in dem mehr Patentverletzungsprozesse geführt werden als in allen anderen teilnehmenden Staaten zusammen, nämlich Deutschland. Bisher hat die deutsche Seite in dieser Frage eine in internationalen Verhandlungen nicht untypische bescheidene Zurückhaltung an den Tag gelegt, wobei sich das mit der Zeit ja ändern kann.
Was nun?
Das Verfahren zur Entscheidung, ob ein Plan B verfolgt wird, mag nun beginnen. Doch es darf nicht nur die oben erläuterten rechtlichen Fragen beinhalten. Es sollte auch die vom BVerfG inhaltlich ungeklärten Fragen angehen. Es wäre gewiss kein verantwortungsvolles politisches Handeln, ein Gerichtssystem ins Leben zu rufen, das absehbaren und vermeidbaren rechtlichen Angriffen vor den Gerichten der Mitgliedsstaaten und vor dem EuGH ausgesetzt wäre.
Ein weiterer Gesichtspunkt muss auf jeden Fall im Auge behalten werden: Das System muss für die Industrie attraktiv bleiben. Die Beträge der Jahresgebühren wurden nach jahrelangen Debatten auf Ebene der vier tatsächlich bedeutsamsten Staaten („true top four“) festgelegt. Der Durchschnittsanmelder, der Schutz in drei oder vier EPG-Vertragsstaaten begehrt, muss in Zukunft zusätzliche Jahresgebühren für das Vereinigte Königreich zahlen. Angesichts dieser Tatsache sind die aktuellen Jahresgebührensätze nicht mehr gerechtfertigt. Der beschränkte Geltungsbereich des Einheitspatents sollte sich also in geringeren Jahresgebühren niederschlagen. Andernfalls wird das Einheitspatent nur von Anmeldern genutzt werden, die den Schutz in vielen Vertragsstaaten aufrechterhalten möchten, beispielsweise von der Pharmaindustrie. Dafür muss wohl der zwischen den Vertragsstaaten erreichte Konsens, dass kein Staat geringere Einkünfte aus Jahresgebühren erhalten soll, als es im System des europäischen Bündelpatents der Fall wäre (was, ehrlich gesagt, ein Konsens zu Lasten der Nutzer ist), auf den Prüfstand gestellt werden.
Zu guter Letzt könnte es sich lohnen, die notwendige Debatte zu nutzen, um mittlerweile erkannte Mängel des EPGÜ zu beseitigen. Die Bestimmungen zu Opt-Out und Opt-In sind als gesetzestechnisch misslungen kritisiert worden. Außerdem gibt es keine tragfähigen Gründe für eine zwangsweise Einbeziehung europäischer Bündelpatente in die Zuständigkeit des EPG: Der freie Wettbewerb zwischen dem EPG und den nationalen Gerichten wäre wohl die bessere Lösung und das EPG würde sich durchsetzen, wenn es im Hinblick auf die Verfahrenseffizienz und die Sachkunde seiner Richter überzeugen kann. Andernfalls wären die Nutzer gezwungen, (vorhandene) Umwege zu gehen, um sich den Zugang zu nationalen Gerichten zu erhalten. Der Entwurf der Verfahrensordnung könnte entschlackt und von Elementen bereinigt werden, die eher britischen als kontinentaleuropäischen Vorstellungen Rechnung tragen. Dies könnte zu einer Vereinfachung des Verfahrens und somit zu einer Kostensenkung führen. In diesem Zusammenhang sind besonders die Höchstbeträge der zu erstattenden Anwaltsgebühren kritisiert worden, da sie für KMUs als kaum tragbar erscheinen.